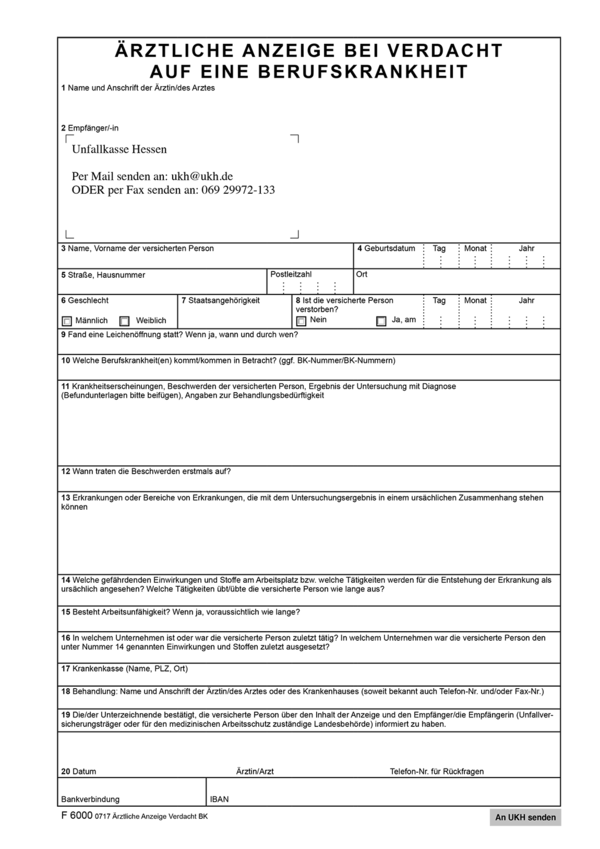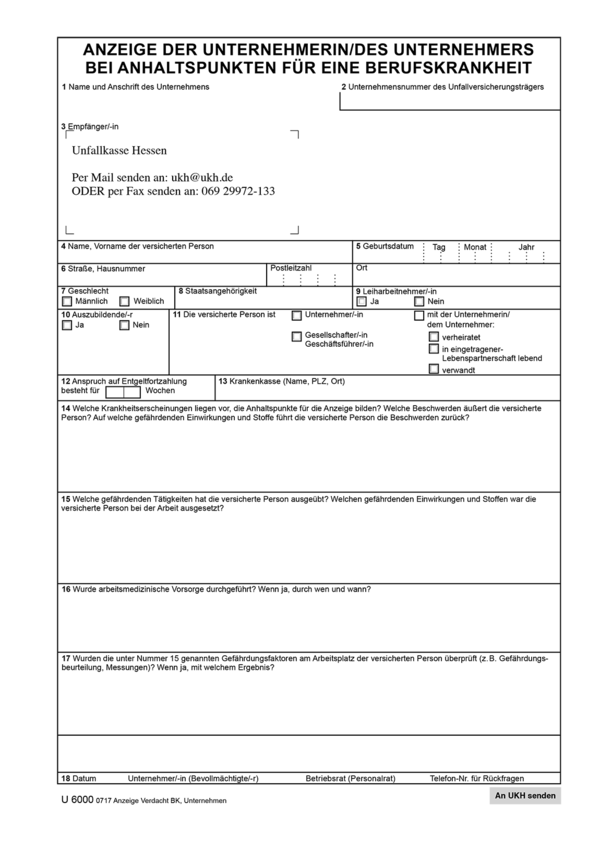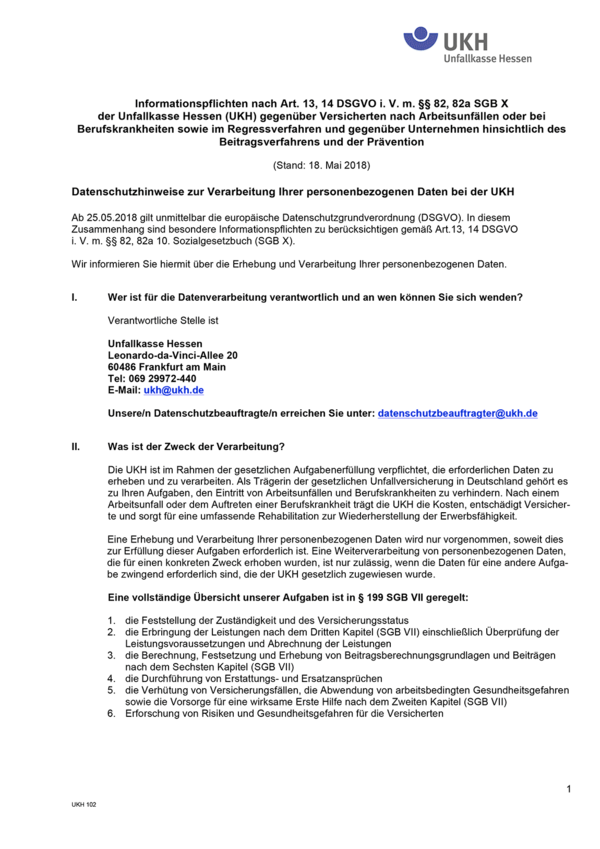Wie kommt eine Krankheit auf die Berufskrankheiten-Liste?
Bis eine Erkrankung in die BK-Liste aufgenommen werden kann, ist mitunter ein "zähes Ringen" um forschungs- und studiengestützte wissenschaftliche Erkenntnisse verbunden: wann sind Personen durch ihre berufliche Tätigkeit besonderen Einwirkungen ausgesetzt?
Die Bundesregierung ist die Verordnungsgeberin. Sie wird hierbei unterstützt und beraten durch den ärztlichen Sachverständigenbeirat „Berufskrankheiten“, ein weisungsunabhängiges Gremium. Dieses Gremium wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) berufen und hat die Aufgabe, den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu sichten und zu bewerten.
Dadurch werden bestehende, gelistete Berufskrankheiten aktualisiert und Empfehlungen ausgesprochen, welche neuen Berufskrankheiten in die BK-Liste aufgenommen werden sollen. Der wesentliche Kern dieses Sachverständigenbeirats besteht aus zwölf Mitgliedern. Überwiegend sind es Hochschullehrer*innen mit der Fachrichtung Arbeitsmedizin – darunter je zwei Gewerbe- und Betriebsärzt*innen. Hinzu kommen vier ständige Berater*innen/Gäste ohne Stimmrecht: zwei von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und zwei von der gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).